Es ist nur ein kurzer Artikel, der am 10. Januar 1835 in der Zeitschrift „Berlin – Eine Wochenschrift“ erscheint. „Nachruf auf Langbein“ ist er überschrieben und beginnt so:
Es ist ein freundlicher Greis heimgegangen; er hat uns manche Stunde erheitert, und die, mit welchen er in seinem hohen Alter verkehrte, haben ihn gleich einem Vater geehrt und geliebt. Ernst Langbein hieß der alte wohlwollende Mann, den vielleicht viele schon längst todt geglaubt, während sie sich noch an seinen muntren Büchern ergötzten.
Ernst Langbein ist es also, dem dieser Nachruf gilt, ein Autor „muntrer Bücher“, wie es der Verfasser des Artikels ausdrückt. Und auch wenn er seinen kurzen Text nicht gezeichnet hat, so darf in ihm durchaus der Gründer und Redakteur der Zeitschrift, also Ludwig Rellstab selbst, vermutet werden. Er muß ihn gemocht haben, diesen Ernst Langbein, denn er fährt in einem ausgesprochen liebevollen Tone fort:
Und doch hat er noch vor wenigen Tagen gelebt, hat noch die Morgensonne des Neujahrs gesehn, sie angelächelt und willkommen geheißen. Aber auch den Tod lächelte er an, als derselbe ihm am zweiten Jahresmorgen den Gruß bot, und da er leise angeklopft, durch die Thürspalte rief: „Beschicke Dich, Freund, um Mittag hole ich Dich heim, und trage Dich sanft hinüber,“ da nickte der Greis lächelnd und sprach für sich: Hab‘ Dich schon lange erwartet. Er warf einen Blick nach oben zu dem gütigen Vater hinauf, dann wandte sich sein freundliches Auge zu der treuen, alten Lebensgefährtin, und blickte sie zum Abschiede noch einmal innig an, und die Hände, die sich vor langen Jahren vor dem Altar zum Gelübde der Liebe und Treue sanft in einander gelegt hatten, drückten sich noch einmal warm und innig, denn was ihr Druck versprochen, hatten sie treulich gehalten. Nun löste der Tod den Bund mit milder Hand; der Greis entschlummerte und himmlischer Friede verklärte seine Züge.
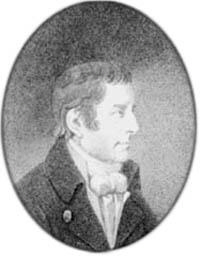
Künstler: unbekannt,
Quelle: Wikimedia Commons,
Lizenz: gemeinfrei, da urheberrechtliche Schutzfrist abgelaufen.
Geboren wird August Friedrich Ernst Langbein am 6. September 1757 in Radeberg bei Dresden als Sohn des Justizamtmannes Ernst Ludwig Langbein und dessen Ehefrau Erdmuthe Charlotte, geborene Michael. Er ist das erste Kind des Paares, dem noch vierzehn weitere folgen sollten. Auch wenn die finanziellen Verhältnisse der Familie eher beschränkt sind, bekommt der Knabe seinen Unterricht von einem Hauslehrer. Bereits mit zwölf Jahren schreibt er erste Verse. 1772 geht er als Fünfzehnjähriger nach Meißen, wo er die nächsten fünf Jahre die Fürstenschule besucht. Anschließend setzt er seine Ausbildung bis 1781 in Leipzig mit einem Jurastudium fort. Und auch literarisch betätigt er sich weiterhin – durchaus mit ersten bescheidenen Erfolgen. 1780 bringt die Zeitschrift „Poetische Blumenlese für das Jahr 1780“ einen Text von ihm, und in Gottfried August Bürgers „Göttinger Musenalmanach“ veröffentlicht er Gedichte. Unmittelbar nach Abschluß seines Studiums tritt er eine Stelle als Vize-Aktuarius in Großenhain an. Weil es dort aber praktisch keine Aufstiegsmöglichkeiten für ihn gibt, wechselt er drei Jahre später nach Dresden. Dies liegt ihm um so mehr am Herzen, als er nach wie vor großes Interesse an literarischen Versuchen hat und es ihm gelungen ist, Kontakt zu den literarischen Kreisen der Elbestadt zu finden.
In Dresden arbeitet er zunächst als Sachwalter und wird 1788 schließlich Kanzlist am Geheimen Archiv. Doch auch hier mangelt es ihm an Aussichten auf Beförderung irgendeiner Art. Zwölf Jahre hält er dennoch aus, bis er sich 1800 schließlich entscheidet, die Juristerei aufzugeben und nach Berlin zu ziehen. Es ist dies auch das Jahr, in dem er seine „treue Lebensgefährtin“, wie Rellstab sie nennt, ehelicht – Johanna Eleonore Reichel, Tochter eines Lohgerbermeisters aus Tharandt.
Berlin ist zu jener Zeit ein kulturelles Zentrum, das viele Intellektuelle und Künstler anzieht, die sich in den Salons der Henriette Herz und der Rahel Levin versammeln, um sich auszutauschen und zu debattieren. Berliner Klassik wird diese Periode später einmal genannt werden. Hier trifft nun also auch Langbein ein und entfaltet sofort eine außerordentlich fruchtbare literarische Tätigkeit. Doch auch wenn er nunmehr gänzlich als Schriftsteller tätig ist – eine Entscheidung, die ihn in Konflikt mit seinem Vater bringt, der ihn gern als Jurist und seinen Nachfolger gesehen hätte -, die Einnahmen, die er mit seinen Romanen und Erzählungen erzielt, reichen nur, um für sich und seine Ehefrau einen äußerst bescheidenen Lebenswandel zu finanzieren. Zwanzig Jahre später erhält er – vermutlich durch die Vermittlung Charlottes von Kalb und Prinzessin Mariannes von Hessen – die Stelle als Zensor für schönwissenschaftliche Schriften. In dieser Funktion soll er recht milde geurteilt und, so erzählen es Zeitgenossen, seine eigenen früheren Schriften aus den zu redigierenden Leihbüchereikatalogen entfernt haben, weil sie frivol und jugendgefährdend seien oder aber von minderer Qualität. Ob dies nur eine gut erzählte Anekdote ist oder aber der Wahrheit entspricht, ist heute nicht mit Sicherheit zu sagen.
Als Mensch gilt August Friedrich Ernst Langbein seinen Mitmenschen als liebenswürdig und wohlwollend. So sieht ihn wohl auch Rellstab, als er dem am 2. Januar 1835 Verstorbenen in seinem Nachruf mit den folgenden Worten ein Denkmal setzt:
Jetzt bedeckt ihn die Erde. Werft Blumen auf sein Grab, denn er war ein Dichter und bestreute schon vor länger als einem halben Jahrhundert, mit Bürger gemeinsam, unsern Lebenspfad mit lieblichen Blüthen. Pflanzt einen schattigen Baum an seine Gruft, denn sein Herz war redlich, freundlich, getreu; es verdient im Kühlen zu ruhen. Setzt ihm einen Denkstein der Ehre, denn seine Brust schlug edel; er ehrte das Recht, die Pflicht, und war, ein zitternder Greis, muthiger in ihrer Ausübung, als viele in rüstiger Manneskraft. Ihr Dichter unserer Vaterstadt habt dies oft erfahren.
So mögen denn die Genien der Liebe, der Treue, der Dankbarkeit und der Verehrung seine Gruft behüten, und am Tage des Erwachens ihn freundlich grüßen und an den Thron des Ewigen führen.
Es mag auffallen, daß Rellstab sein Denkmal hier in erster Linie der Person Langbeins, nicht so sehr aber dem Dichter setzt. Vielleicht drückt sich damit ein Urteil aus, daß er in seinem Nachruf nicht unmittelbar zum Ausdruck bringen will – ein Urteil, mit dem sich Rellstab in Übereinstimmung mit der heutigen Literaturwissenschaft wiederfände. Denn auch wenn August Friedrich Ernst Langbein ein äußerst produktiver Schriftsteller war, der seine zuvor meist einzeln in Almanachen, Taschenbüchern und Zeitschriften erschienenen Verserzählungen, Schwänke, Märchen, Legenden und Romane in insgesamt 23 Sammlungen selbst herausgab und in seiner Zeit von seinem Publikum mit großem Vergnügen gelesen wurde, so kann er im Urteil der heutigen Literaturwissenschaft kaum eigenständige künstlerische Leistungen hinsichtlich Inhalt und Form seiner Werke aufweisen. Manche sind sogar der Meinung, er habe keine wirkliche dichterische Begabung besessen.
Nun, ganz so unbegabt kann er nicht gewesen sein. Immerhin nimmt ihn Christoph Martin Wieland 1788 in seinen „Teutschen Merkur“ auf, und auch im „Musen-Almanach“ Friedrich Schillers erscheinen 1796 und 1797 Werke von ihm. Und Schriftsteller wie Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller und E. T. A. Hoffmann finden bei ihm Anregungen für ihre gewählten Stoffe. Seine Literatur dient vorwiegend der Unterhaltung, was aber kein Mangel ist (oder es zumindest nicht sein sollte) und was ihm sein Publikum durchaus zu danken weiß. Besonders seine komischen Erzählungen, für die er durchaus einen eigenen Stil entwickelt, kommen an – seine Schwänke, der komische Roman „Tomas Kellerwurm“ von 1806 und die lustige Geschichte „Schmolke und Bakel“ sind hier zu nennen. Fabeln und Novellen gehören ebenso zu seinem Werk wie lyrische Gedichte. Seine Beliebtheit ist zu seiner Zeit so groß, daß verschiedene unbekanntere Schriftsteller ihre Werke zeitweilig unter seinem Namen veröffentlichen oder wenigstens das Prädikat „in Langbeins Manier“ darauf setzen. Und liegt nicht am Ende Kunst immer im Auge des Betrachters oder – in diesem Falle – des Lesers?
August Friedrich Ernst Langbein wird nach seinem Tode auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt. Allerdings ist seine Grabstätte heute leider nicht mehr vorhanden.
„Berlin – eine Wochenschrift“ war eine Zeitschrift, die am 3. Januar 1835 erstmals erschien und vom Verlag Duncker & Humblot, Berlin herausgegeben wurde. Immer einmal in der Woche, am Sonnabendmorgen, stand den Lesern eine neue Nummer zur Verfügung, die sich mit der Kunst, der Literatur und dem Theater der Stadt beschäftigte. Gründer und Redakteur des Blattes war der Dichter Ludwig Rellstab. Schriftstellerkollegen wie Willibald Alexis, Friedrich von Raumer und Friedrich Rückert lieferten Beiträge. Ein lange Existenz war der Zeitschrift allerdings nicht beschieden. Bereits mit dem Ende des Jahres stellte sie ihr Erscheinen mit der letzten Nummer vom 26. Dezember 1835 wieder ein.
Quellen
- Nachruf an Langbein, In: Berlin – eine Wochenschrift, Verlag Duncker & Humblot, Berlin, Ausgabe 2 vom 10. Januar 1835
- Marion Beaujean: Langbein, August Friedrich Ernst, In: Neue Deutsche Biographie 13 (1982), S. 546 f.
- Joseph Kürschner: Langbein, August Friedrich Ernst, In: Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 17 (1883), S. 620, Digitale Volltext-Ausgabe in Wikisource (Version vom 9. Dezember 2015, 08:29 Uhr)
- Alfred Etzold: Der Dorotheenstädtische Friedhof – Die Begräbnisstätten an der Berliner Chausseestraße, Aktualisierte Neuausgabe des Bandes von 1993, 1. Auflage 2002, Christoph Links Verlag – LinksDruck GmbH, Berlin, 1993
Informationen zum Banner auf dieser Seite finden Sie hier.
